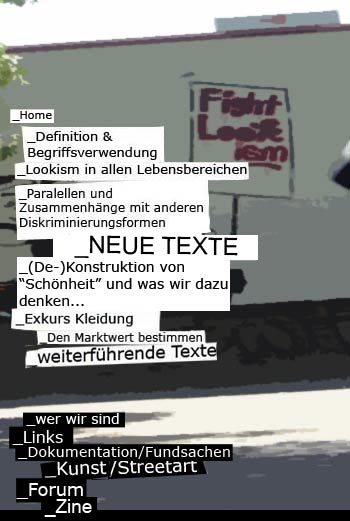
„Schön“ und „hässlich“ und was das mit (geschlechtlicher) Normierung zu tun hat
Lookism – das ist ja was ganz neues?! Ist der Begriff auch eher unbekannt, beschreibt er dennoch einen gewohnten und ganz alltäglichen Mechanismus. Menschen werden in „schön“, „hässlich“ oder irgendwo „dazwischen“ eingeteilt und erhalten aufgrund dessen Vor- oder Nachteile. Das ist – kurz gefasst - Lookism.
Was „schön“ und „hässlich“ ist, wird durch gesellschaftliche Prozesse bestimmt. Menschen, die dem gerade vorherrschenden Schönheits- bzw. Körperideal nicht entsprechen, werden ausgegrenzt. Es ist schwieriger, Freund_innen(*1) zu finden, mensch muss besonders viele Qualitäten aufweisen, dass sich „trotzdem“ eine_r in sie_ihn verliebt, unter Umständen gibt es scheiß Blicke und Sprüche in der Straßenbahn oder anderswo im öffentlichen Raum. Diese gesellschaftlich konstruierten Ideale werden meist verinnerlicht und auch auf sich selbst angewendet, so dass mensch noch nicht mal bei der Selbstbetrachtung von diesen verschont bleibt. Lookism überall und kein Entrinnen...
Genauso wie die Vorstellung von Geschlecht ist auch das Schönheitsideal je nach Kultur, Zeit und sozialem Umfeld völlig unterschiedlich. So galten früher beispielsweise dickere Menschen als „schöner“ und in China waren bis ins 20.Jahrhundert kleine Füße der Inbegriff weiblicher „Schönheit“, weshalb die Kinderfüße der Mädchen(*2) fest „geschnürt“ und die Zehen gebrochen wurden; in Europa wiederum zwängten sich Frauen in Korsetts (oder wurden gezwängt). Und ob zum Beispiel sonnengebräunte Haut als „schön“ wahrgenommen wird, ist auch zeitlich und kulturell bedingt.
Weltweit gesehen spielt auch die westlich weiße Vorherrschaft aufgrund von (post-)kolonialen Strukturen eine Rolle.So haben in vielen asiatischen Ländern fast alle kosmetischen Produkte einen „whitening“-Effekt, d.h. sie enthalten Wirkstoffe, die die Haut bleichen - unter anderem mit dem Ziel, dem weiß-westlichen Bild näherzukommen, das auch in TV und Werbung gezeigt wird. Um „westlichere“ Augen zu bekommen, ist in Teilen Asiens die Lidoperation sehr beliebt.(*3)
Schaut mensch sich Lookism näher an, fällt auch auf, dass es gewisse strukturelle Parallelen zu anderen Unterdrückungsmechanismen gibt. So werden zum Beispiel sowohl bei Sexismus, Rassismus, Ableism(*4), Ageism(*5) als auch bei Lookism Menschen unter anderem(*6) anhand ihrer Körper nach einem hierarchischen Prinzip beurteilt. Sie erhalten auf Grund körperlicher Merkmale unterschiedlichen Status und/oder ihnen werden mit Werturteilen versehene Eigenschaften zugeschrieben.
Aber zurück zum jeweiligen Schönheitsideal. Je näher mensch diesem kommt, umso besser für den Marktwert, sowohl „beruflich“ als auch im „Privaten“. Denn auch hier ist es wichtig, sich „gut zu verkaufen“, also eigene Vorzüge, auch die äußeren, in den Vordergrund zu stellen. So spielt es beim Aussuchen von Freund_innen meist auch eine Rolle, ob sie den eigenen Wert steigern oder zumindest den gleichen Marktwert besitzen wie mensch selber (denn wer will sich schon innerhalb des eigenen Umfeldes für Freund_innen „schämen“ müssen?).
Diskriminierung aufgrund des Aussehens hat aber nicht nur mit Idealbildern, sondern auch viel mit gesellschaftlichen Normen zu tun, die den Schönheitsidealen den Rahmen vorgeben. Bestimmtes Aussehen ist „normal“. Und ist mensch nicht „normal“ – weil sie_er den aufgedrückten Erwartungen nicht entsprechen kann oder will, dann wird sie_er ausgegrenzt und angegriffen.
Aber nicht für jede_n gelten dieselben Normen. Welche Schönheitsnormen für wen zum Tragen kommen, hängt von mehreren Faktoren ab. Eine große Rolle spielt dabei das gesellschaftlich zugeteilte Geschlecht. So gelten Haare an den Beinen gesellschaftlich mal als „hässlich“, mal nicht – je nachdem, ob das Bein von einer Frau oder einem Mann ist(*7). Von einer Frau wird also nicht nur das passende „weibliche“ Verhalten verlangt, sondern auch das dementsprechende Aussehen (und für Frauen ist das Aussehen tendenziell immer noch wichtiger als für Männer(*8)), ein Typ dagegen muss wie ein „richtiger“ Mann aussehen - sonst käme ja noch die Geschlechterordnung durcheinander..
Das Schönheitsempfinden ist also, genauso wie die Vorstellung von Geschlechtern und Sexualität, weder angeboren, „natürlich“ oder gänzlich individuell, sondern immer von sozialen Normen und gesellschaftlichen Machtverhältnissen beeinflusst. Klar haben alle unterschiedliche Lebensumstände und das Schönheitsempfinden der einzelnen ist daher auch nie absolut identisch, aber auch ein „total eigenes“ Schönheitsempfinden wird trotzdem - und das nicht nur zufällig - in vielen Punkten mit dem gesellschaftlichen oder szeneinternen Schönheitsideal übereinstimmen. Und „Schönheit“ lässt sich nicht ohne „Hässlichkeit“ denken, wodurch es zwangsläufig zu einer Hierarchisierung von Individuen kommt.
Einerseits gibt es den Slogan „Liebe deinen Körper, so wie er ist!“, der auch in sogenannten „Frauenzeitschriften“ zu finden ist, während andererseits fast nur normentsprechende Körper gezeigt werden und die Wichtigkeit des Äußeren betont wird. Wie also soll mensch ihren_seinen Körper vorbehaltlos mögen, solange es gesellschaftliche/szeneinterne/.. Normvorstellungen von „schön“ und „hässlich“, von einem „richtigen“ und „falschen“ Körper gibt?
Deshalb: Weg mit diesen Kategorien! Klar ist es toll, etwas „schön“ zu finden. Problematisch wird es ja auch erst, wenn es sich nicht um Gegenstände dreht, sondern Individuen ins „schön-hässlich“-Raster gepackt werden. Genauso wie Geschlecht und Hautfarbe bei der Bewertung von anderen nicht nur eine untergeordnete Rolle, sondern gar keine spielen sollten, sollte unserer Meinung nach ein Individuum generell nicht aufgrund bestimmter Körperformen/-Merkmale auf- oder abgewertet werden.
Was nicht heißt, dass mensch niemanden mehr schön, im Sinne von toll/angenehm/sexy/..., finden soll. Wir denken, dass es genug andere Möglichkeiten und Gründe gibt, sich selber und andere zu mögen, nämlich was sie_er tut und sagt – und da gibt es ja mehr als genug Sachen, die mensch großartig (oder scheiße) finden kann!
Schönheitsvorstellungen drehen sich nicht nur um den Körper, sondern umfassen auch die „passende“ Kleidung und Körpergestaltung, wobei es auch hier meist ganz unterschiedliche Erwartungen je nach angenommenem Geschlecht gibt.
Diskriminierung aufgrund „unpassender“ Kleidung findet einerseits zwischen (Sub-)Kulturen und Szenen mit konträren Kleidungsnormen statt, aber es gibt auch Diskriminierung innerhalb einer Szene, wenn es einem Menschen nicht gelingt (oder sie_er sich verweigert), dem internenSchönheitsideal und Kleidungscode zu entsprechen.
Andererseits gibt es Menschen, die nach gesellschaftlicher/szeneinterner Ansicht den „richtigen“ Stil haben, diese haben die „richtige“ Kleidung in der „richtigen“ Kombination mit den „richtigen“ Accessoires und sind deshalb „schön“ angezogen, was ihren Marktwert erhöht. Dieser „richtige“ Stil ist von gesellschaftlichen/szeneinternen Nomen geprägt und daher auch je nach Zeitpunkt inhaltlich total unterschiedlich besetzt.
Allerdings lässt sich Kleidung nicht nur unter diesen Geschichtspunkt fassen. Einen Menschen abzuwerten, weil sie_er sich beispielsweise nicht die „passende“ Modemarke leisten kann, ist eine Form von Ausgrenzung. Aber andererseits können durch Kleidung auch bewusst politische Aussagen transportiert werden – und es macht durchaus Sinn, eine Person nach diesen zu beurteilen (ein extremes Beispiel wäre eindeutig rechtsradikale Kleidung/Symbolik).
Also können Kleidung und andere Körpergestaltungen auch ein Mittel sein, sich selbst (politisch) auszudrücken und zu verorten. Unter Umständen kann Kleidung sogar einer subversiven Praxis dienen, zum Beispiel kann durch Kleidung/Schminke/etc. die herrschende Geschlechterordnung durcheinander gebracht werden. So stellt ein Typ mit Nagellack und Rock durchaus die heterosexistische Männlichkeitsvorstellung in Frage.
Durch solche Normbrüche kann nicht nur die geschlechtliche Ordnung aufgebrochen werden, sondern mensch kann auch dem gesellschaftlichen Konsens von „schön“ und „hässlich“ etwas entgegensetzen. Normen von Geschlecht (und damit auch Schönheit) lassen sich spielerisch und parodistisch umdrehen - und stellen somit das „Normale“ in Frage. Dies ist auch eine Idee der Queer Theory. Dieses politische Konzept wendet sich gegen Normierungen jeglicher Art und beinhaltet auch eine kritische Auseinandersetzung mit möglichen Ausschlüssen innerhalb der eigenen (Sub-)Kultur. Daher richtet sich Queer als politischer Begriff auch gegen Lookism.
Eine andere, auch in der Queer Theory bekannte Strategie ist es, sich ursprünglich abwertende Bezeichnungen oder Kennzeichen anzueignen und positiv zu besetzen. Auch mit dieser Strategie können Schönheitsvorstellungen gestört werden. Ganz nach dem Motto „Fat and Proud“ - einem Slogan des Fat Liberation Movement(*9), einer Bewegung, die gegen Diskriminierung und Vorurteile gegenüber dickeren Menschen kämpft und vor allem in den USA zu verorten ist.
Fight lookism? Menschen nicht nach ihrem Körper zu beurteilen, ist meist schwieriger als gedacht. Selbst wenn Gegenstrategien bestehen und von dem Konzept von „schön“ und „hässlich“ theoretisch Abstand genommen wird, lassen sich die damit verbundenen, schon lange verinnerlichten Denkmuster nicht einfach so streichen. Das kann nur ein Prozess sein. Davon abgesehen, dass es im realen Leben weiterhin einen riesigen Unterschied macht, ob mensch dem Schönheitsideal entspricht oder eben nicht – mit den damit verbundenen Vor-oder eben Nachteilen!
Obwohl es also eher trostlos aussieht, Normzustände sich nicht einfach so ändern lassen und es noch genug andere Probleme auf der Welt gibt, denken wir, dass es trotzdem Sinn macht, sich über die Vielzahl und Verschränkungen von Unterdrückungsverhältnissen bewusst zu werden und damit auch eigenes Verhalten, Positionen und eventuelle Privilegien kritisch zu hinterfragen.In diesem Sinne: Radicalize yourself.
__________________________________________________
(1) Der Unterstrich „.._innen“ soll die Funktion haben, dass nicht nur Frauen mitgedacht werden, sondern auch Menschen, die sich zwischen/außerhalb der Zweigeschlechtlichkeit verorten.
(2) Also die Kinder, die der Kategorie „weiblich“ zugeordnet wurden. Wir gehen davon aus, dass die Geschlechterordnung bzw. die Zweigeschlechtlichkeit gesellschaftlich konstruiert ist, sprechen im Text aber trotzdem von Frau/Mann, da diese Konstrukte die Gesellschaft strukturieren und als Gewaltverhältnisse real wirksam sind.
(3) Was nur zeigt, dass das Schönheitsideal immer und überall etwas mit Machtstrukturen zu tun hat.
(4) Ableism ist die Diskriminierung von Menschen mit „Behinderung“, da sie nicht in die gesellschaftliche Norm passen.
(5) Ageism bedeutet soziale und ökonomische Benachteiligung von Personen aufgrund ihres Lebensalters.(6) Dieses „unter anderem“ ist wichtig, da diese Mechanismen komplexer sind, als dass sie sich nur auf die Formel „Diskriminierung aufgrund des Körpers“ zusammenfassen ließen.
(7)Jedoch ist es in Teilen der linken Szene als Frau eher verpönt, sich zu rasieren (wobei sich die Frage auftut, ob es mit der Etablierung einer Gegen-Norm getan ist).
(8)Wobei die Vorstellung, dass Sich-Schön-Machen immer nur Frauensache war, eher als ein Mythos zu bewerten ist. „Denn im klassischen Griechenland galt beispielsweise der Männerkörper als attraktiver, "adonisch" heißt schön. Schönheit als Frauensache ist eine moderne Zuschreibung. Bis zum frühen 18. Jahrhundert etwa war die Geschlechterdifferenzierung in der Mode weniger wichtig als die Differenzierung nach Klasse.“ (Nina Degele: „Wie´s gefällt“, Freitag 39, http://www.freitag.de/2004/39/04392301.php)
(9) Ganz viel darüber steht im engl. Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Sizeism